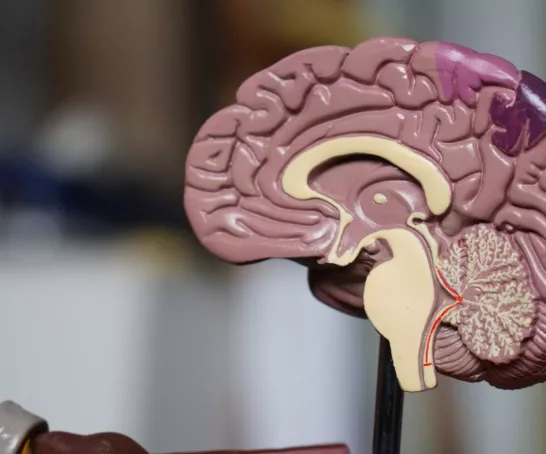Akademischer Werdegang
- Seit 2022 Professor für Psychologie an der AKAD Hochschule Stuttgart
- Seit 2020 Leiter der Sektion für molekulare Genetik und forensische Verhaltenswissenschaften der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinik Ulm
- 2020 – 2022 Stationspsychologe an der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie, BKH Günzburg, Deutschland
- 2021 – 2022 Dozent an der IU Hochschule für Allgemeine Psychologie I, Biopsychologie: biologische Grundlagen der Psychologie und Klinische Psychologie: Störungslehre
- Seit 2021 Ausbildung zum Fachpsychologen für Rechtspsychologie, Straffähigkeitsgutachter am LG Memmingen
- 2018 – 2020 Gastlektor am Institut für Psychiatrie und Verhaltens-wissenschaften, Stanford School of Medicine, Stanford Universität, USA
- 2016 – 2017 3monatiger Aufenthalt als Gastwissenschaftler am Nationalen Institut für Drogensucht (NIDA) und dem Johns-Hopkins-Krankenhaus, Baltimore, USA im Labor von Dr. Michael Michaelides
- 2014 – 2020 Assistenz (Junior) Professor am Zentrum für Soziale und Affektive Neurowissenschaften der Universität Linköping (Zentrumleitung Univ. Professor DDr. Markus Heilig). Leitung von Forschungsprojekten über Sigma 2 und Acetylcholin Rezeptoren als molekulare Ziele zur Behandlung von Kokainabhängigkeit
- 2010 – 2014 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Klinische und Experimentelle Medizin der Universität Linköping, Schweden (Labor von Herrn Univ. Professor David Engblom). Mitarbeit an den Projekten „Circuits and mechanisms behind sickness-induced aversion and depressive symptoms“ und „Inflammation-induced aversion: Brain Circuitry and Molecular Mechanisms“
- 2010 Promotion (Dr. rer. nat.) mit Auszeichnung über das Thema „Cocaine relapse prevention by social interaction and sigma 1 receptor inactivation: Development of an animal model“
- 2008 – 2010 Doktorats Studium Psychologie an der Abteilung für Experimentelle Psychiatrie der Medizinischen Universität Innsbruck unter Anleitung von Herrn ao. Univ.-Professor Dr. med. univ. Gerald Zernig
- 2003 – 2004 Magisterstudium Philosophie Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
- 2001 – 2003 Bakkalaureats Studium Philosophie Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
- 2000 – 2008 Magisterstudium Psychologie Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Publikationen
Mitgliedschaft und Funktion in wiss. Vereinigungen und Gremien
- Mitglied des Berufsverbandes österreichischer Psychologen und Psychologinnen (BOEP)
- Mitglied der Society for Neuroscience (SfN)
Preise, Stipendien und Ehrungen und ggf. Patente
- 2016 Reisestipendium der Knut and Alice Wallenberg Foundation
- 2014 Reisestipendium der Knut and Alice Wallenberg Foundation
- 2009 Reisestipendium der Internationalen Gesellschaft für Neurochemie (ISN)
Publikationen
- 2022 Streb J, Lutz M, Dudeck M, Klein V, Maaß C, Fritz M& Franke I: Are women really different? Comparison of Men and Women in a Sample of Forensic Psychiatric Inpatients. Frontiers in Psychiatry, 2022.
- 2021 Klawonn, A. M., Fritz, M., Castany, S., Pignatelli, M., Canal, C., Simil, F., Tejeda, H. A., Levinsson, J., Jaarola, M., Jakobsson, J., Hidalgo, J., Heilig, M., Bonci, A., & Englom, D. Microglial activation elicits a negative affective state through prostaglandin-mediated modulation of striatal neurons. Immunity, 2021, 54:1-10.
- 2021 Fritz M, Rösel F, Dobler H, Streb J, Dudeck M. Childhood Trauma, the Combination of MAO-A and COMT Genetic Polymorphisms and the Joy of Being Aggressive in Forensic Psychiatric Patients. Brain Sciences, 2021, 11, 1008. doi: 10.3390/brainsci11081008.
- 2020 Fritz M, Shenar R, Cardenas-Morales L, Jäger M, Streb J, Dudeck M, Franke I. Aggressive and Disruptive Behavior Among Psychiatric Patients With Major Depressive Disorder, Schizophrenia, or Alcohol Dependency and the Effect of Depression and Self-Esteem on Aggression. Front Psychiatry. 2020, 11:599828.
- 2020 Fritz M, Klawonn AM, Zhao Q, Sullivan EV, Zahr NM, Pfefferbaum A. Structural and biochemical imaging reveals systemic LPS-induced changes in the rat brain. J Neuroimmunol. 2020, 348:577367.
- 2018 Zhao Q, Fritz M, Pfefferbaum A, Sullivan EV, Pohl KM, Zahr NM. Jacobian Maps Reveal Under-reported Brain Regions Sensitive to Extreme Binge Ethanol Intoxication in the Rat. Front Neuroanat. 2018, 12:108.
- 2018 Klawonn AM, Fritz M, Nilsson A, Bonaventura J, Shionoya K, Mirrasekhian E, Karlsson U, Jaarola M, Granseth B, Blomqvist A, Michaelides M, Engblom D. Motivational valence is determined by striatal melanocortin 4 receptors. J Clin Invest. 2018, 128(7): 3160-3170.
- 2018 Klawonn AM, Wilhelms DB, Lindström SH, Singh AK, Jaarola M, Wess J, Fritz M, Engblom D. Muscarinic M4 Receptors on Cholinergic and Dopamine D1 Receptor-Expressing Neurons Have Opposing Functionality for Positive Reinforcement and Influence Impulsivity. Front Mol Neurosci. 2018, 11: 139.
- 2018 Fritz M, Klawonn AM, Jaarola M, Engblom D. Interferon-ɣ mediated signaling in the brain endothelium is critical for inflammation-induced aversion. Brain Behav Immun. 2018, 67: 54-58.
- 2017 Klawonn AM, Nilsson A, Rådberg CF, Lindström SH, Ericson M, Granseth B, Engblom D, Fritz M. The Sigma-2 Receptor Selective Agonist Siramesine (Lu 28-179) Decreases Cocaine-Reinforced Pavlovian Learning and Alters Glutamatergic and Dopaminergic Input to the Striatum. Front Pharmacol. 2017, 8: 714.
- 2017 Singh AK, Zajdel J, Mirrasekhian E, Almoosawi N, Frisch I, Klawonn AM, Jaarola M, Fritz M, Engblom D. Prostaglandin-mediated inhibition of serotonin signaling controls the affective component of inflammatory pain. J Clin Invest. 2017, 3;127(4): 1370-1374.
- 2016 Fritz M, Klawonn AM, Nilsson A, Singh AK, Zajdel J, Wilhelms DB, Lazarus M, Löfberg A, Jaarola M, Kugelberg UÖ, Billiar TR, Hackam DJ, Sodhi CP, Breyer MD, Jakobsson J, Schwaninger M, Schütz G, Parkitna JR, Saper CB, Blomqvist A, Engblom D. Prostaglandin-dependent modulation of dopaminergic neurotransmission elicits inflammation-induced aversion in mice. J Clin Invest. 2016, 126(2): 695-705.
- 2012 El Rawas R, Klement S, Salti A, Fritz M, Dechant G, Saria A, Zernig G. Preventive role of social interaction for cocaine conditioned place preference: correlation with FosB/DeltaFosB and pCREB expression in rat mesocorticolimbic areas. Front Behav Neurosci. 2012, 2;6: 8.
- 2012 El Rawas R, Klement S, Kummer KK, Fritz M, Dechant G, Saria A, Zernig G. Brain regions associated with the acquisition of conditioned place preference for cocaine vs. social interaction. Front Behav Neurosci. 2012, 6: 63.
- 2011 Fritz M, El Rawas R, Klement S, Kummer K, Mayr MJ, Eggart V, Salti A, Bardo MT, Saria A, Zernig G. Differential effects of accumbens core vs. shell lesions in a rat concurrent conditioned place preference paradigm for cocaine vs. social interaction. PLoS One. 2011, 6(10): e26761.
- 2011 Fritz M, Klement S, El Rawas R, Saria A, Zernig G. Sigma1 receptor antagonist BD1047 enhances reversal of conditioned place preference from cocaine to social interaction. Pharmacology. 2011, 87(1-2): 45-8.
- 2011 Fritz M, El Rawas R, Salti A, Klement S, Bardo MT, Kemmler G, Dechant G, Saria A, Zernig G.Reversal of cocaine-conditioned place preference and mesocorticolimbic Zif268 expression by social interaction in rats. Addict Biol. 2011, 16(2): 273-84.
- 2010 Fritz M, Wallner R, Grohs U, Kemmler G, Saria A, Zernig G. Comparable sensitivities of urine cotinine and breath carbon monoxide at follow-up time points of three months or more in a smoking cessation trial. Pharmacology. 2010, 85(4): 234-40.
Review Artikel
- 2019 Fritz M, Klawonn AM, Zahr NM. Neuroimaging in alcohol use disorder: From mouse to man. J Neurosci Res. 2019, 10.1002/jnr. 24423.
Buchkapitel
- 2022 Fritz M, Dudeck M: Die Neurobiologie der Delinquenz. In: Häßler F, Nedopil N, Dudeck M: Praxishandbuch Forensische Psychiatrie. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- 2022 Fakhoury M, Fritz M., Sleiman SF: Behavioral Paradigms for Assessing Cognitive Functions in the Chronic Social Defeat Stress Model of Depression. Neuromethods, 2022, 179, pp. 147-167.
- 2021 Klawonn, A.M., Fritz M.: Immune-to-Brain Signaling Effects on the Neural Substrate for Reward: Behavioral Models of Aversion, Anhedonia, and Despair. Neuromethods, 2021,165,pp. 145-167.
Studiengänge der Professor:innen
Letzte Beiträge der Professor:innen
Fragen zum Studium
Termin
Sofort

Fragen zum Studium
Sofort
Info-Event
Termin

Kostenloses Infomaterial anfordern